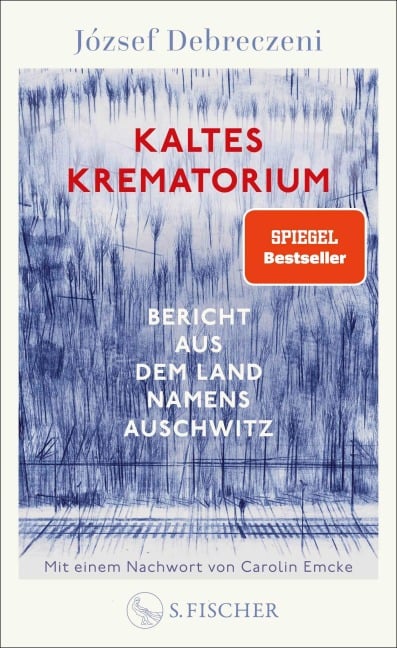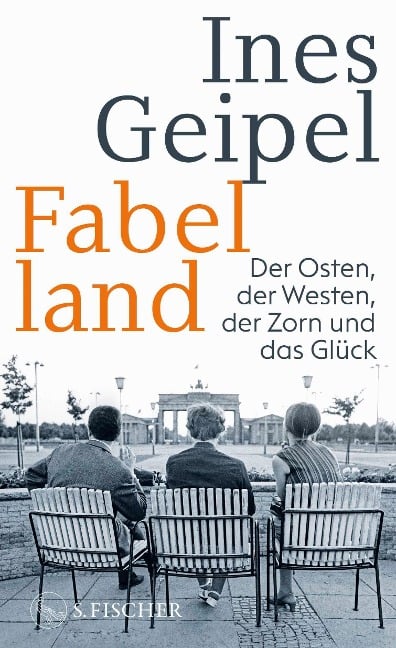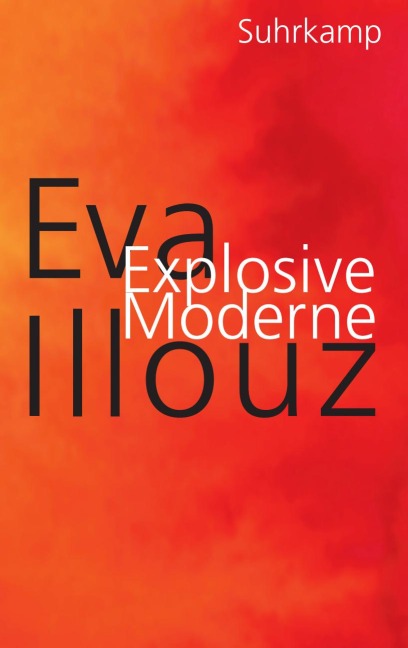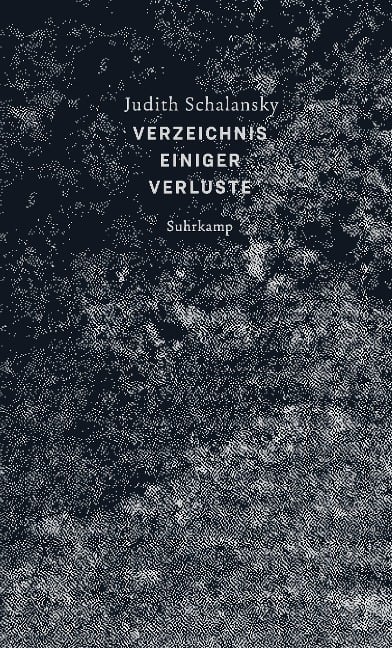Kaltes Krematorium József Debreczeni
gebunden
József Debreczeni war ein ungarischer Jude, der bereits vor dem zweiten Weltkrieg als Schriftsteller und Journalist hervortrat. 75 Jahre nach dem Erscheinen liegt sein Bericht aus dem „Land namens Auschwitz“ endlich auf Deutsch vor. Debreczeni musste als Jude zunächst Zwangsarbeit in einem Arbeitsbataillon leisten und wurde im Mai 1944 nach Auschwitz deportiert. Er überstand dort die Selektion, wurde als arbeitsfähig eingeordnet und aus Auschwitz in verschiedene Arbeitslager auf polnischem Boden verbracht. Die Befreiung durch die rote Armee im Mai 1945 erlebte er in dem Zwangsarbeiterlager Dörnhau, das zum Außenlagersystem des Konzentrationslagers Groß-Rosen gehörte. Das titelgebende „Kalte Krematorium“ war die Krankenstation in Dörnhau, die viele nicht und József Debreczeni nur knapp überlebte.
Das Einzelschicksal von József Debreczeni ist Teil der Geschichte der Vernichtung der ungarischen Juden, die nach der Eroberung Ungarns durch Deutschland im März 1944 begann. „Zu diesem Zeitpunkt befanden sich in Ungarn etwa 800.000 Juden in Folge der ungarischen Annexion von Gebieten der Slowakei, Rumäniens und Jugoslawiens. Im Mai 1944 begannen die Deportationen nach Auschwitz-Birkenau. Etwa 424.000 Juden wurden innerhalb von 56 Tagen in Zügen deportiert. Diese Mordkampagne wurde effizient und systematisch von einem nationalsozialistischen Stab unter der Leitung von Adolf Eichmann durchgeführt. Sie wurde durch die volle Kollaboration der ungarischen Behörden bis Juli 1944 ermöglicht.“ (Dokumentation der Gedenkstätte Yad Vashem).
József Debreczeni hat seinen Bericht bereits 1950 vorgelegt. Die Lektüre ist zutiefst erschütternd und doch ist es ein brillanter Text, der von einer professionellen Schärfe der Beobachtung und Analyse ebenso zeugt, wie von einer literarischen Verdichtung und Aufbereitung. Messerscharf beschreibt Debreczeni die stufenweise Entmenschlichung der Gefangenen durch die SS und ihre Lakaien, er analysiert präzise das Herrschaftssystem der Lager, dass dadurch gekennzeichnet war, dass die SS einzelne Gefangene – vorzugsweise solche mit kriminellem Hintergrund – zu einer „Lageraristokratie“ (Debreczeni) aus Lagerältesten, Blockältesten und sonstigen Funktionshäftlingen („Kapos“) gemacht hat, die Privilegien genoss und die alltägliche Repression und Aufrechterhaltung der „Lagerordnung“ übernahm. Und er berichtet schonungslos von dem alltäglichen Grauen, der allgegenwärtigen Gewalt, dem Sadismus der SS, der Niedertracht der zivilen Mitarbeiter der Unternehmen, die Nutznießer der Zwangsarbeit waren; er erzählt vom Hunger, dem Schmutz und dem Gestank. Und er spricht von der menschlichen Solidarität unter den Gefangenen und der verzweifelten Hoffnung, durchzuhalten bis zur endgültigen und 1944 auch für die Gefangenen absehbaren Niederlage Deutschlands.
„József Debreczenis ‚Kaltes Krematorium‘ ist einzigartig. Es lässt sich allenfalls mit Primo Levis ‚Ist das ein Mensch?‘ vergleichen. Doch es steht allein und hebt sich ab. ‚Kaltes Krematorium‘ ist von gnadenloser Präzision. Hier schreibt jemand, der immer schon die Wirklichkeit beobachtet und beschrieben hat. Was Debreczeni erzählt: Es ist nicht auszuhalten, und es gehört doch ausgehalten. Es ist unerträglich, und es muss angenommen werden als Aufgabe. Wir müssen es als unerträglich erkennen und es zu ertragen versuchen. Es ist geschehen und dauert an. Auschwitz setzt alle lineare Zeit aus. Es hat etwas Flirrendes, das vergangen ist und doch da vor unseren Augen in seiner ganzen Abgründigkeit gegenwärtig wird.“ (Carolin Emcke im Nachwort).
„Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.“ (Primo Levi)
Nie wieder ist jetzt!
Die Wiederentdeckung nach 70 Jahren, erstmals auf Deutsch: »Ein literarischer Diamant, scharfkantig und kristallklar«, schreibt die »Times« über József Debreczenis Erinnerungen an Auschwitz . Sein bewegender Bericht aus den Vernichtungslagern gilt als eines der größten Werke der Holocaust -Literatur. In ihrem Vorwort setzt sich Carolin Emcke mit diesem bewegenden Memoir eines Überlebenden auseinander und reflektiert darüber, was es für uns heute bedeutet, dieses Buch zu lesen.
Der renommierte ungarische Journalist und Dichter József Debreczeni wurde 1944 als Jude nach Auschwitz deportiert, es folgten zwölf albtraumhafte Monate in verschiedenen Konzentrationslagern . Seine letzte Station war das »Kalte Krematorium«, die Krankenbaracke des Zwangsarbeitslagers Dörnhau.
Kurz nach der Befreiung schrieb József Debreczeni seinen Bericht: eine gnadenlose Anklage von höchster literarischer Qualität. Mit präzisen Beschreibungen, dem Mittel der Ironie und mitunter einem beißenden Humor bringt er uns die Menschen nahe, denen er in der Haft begegnet ist und deren Erfahrungen in den Lagern mit dem Verstand kaum zu begreifen sind. Erstmals 1950 auf Ungarisch veröffentlicht, geriet es in Vergessenheit - mehr als 70 Jahre später wurde es in 15 Sprachen übersetzt. »Eine eindringliche Chronik von seltener, beunruhigender Kraft.« The Times »Ein enorm kraftvoller und zutiefst humaner Augenzeugenberciht über den Horror der Lager. Mit lebhaften Beschreibungen vermittelt Debreczeni dem Leser die spezifische, konkrete und mörderische Realität des Holocaust.« Karl Ove Knausgaard »Ein außergewöhnliches Memoir ... ein unvergessliches Zeugnis.« Kirkus Review
zum Produkt
€ 25,00*
 Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".
Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".