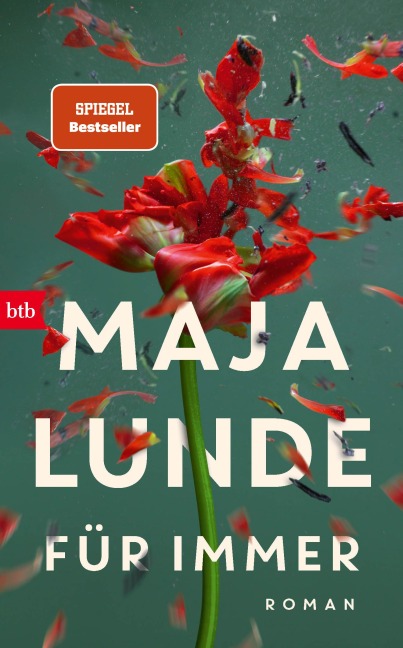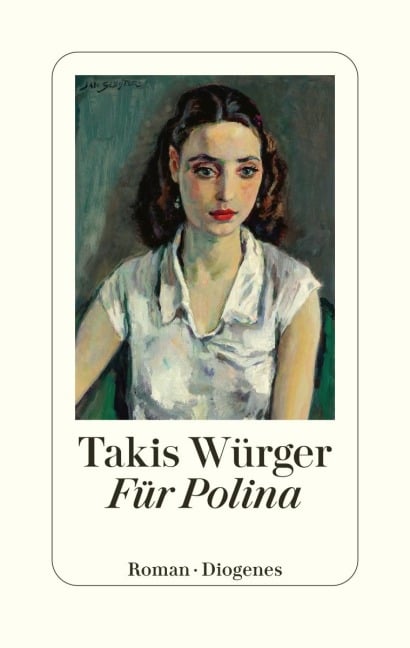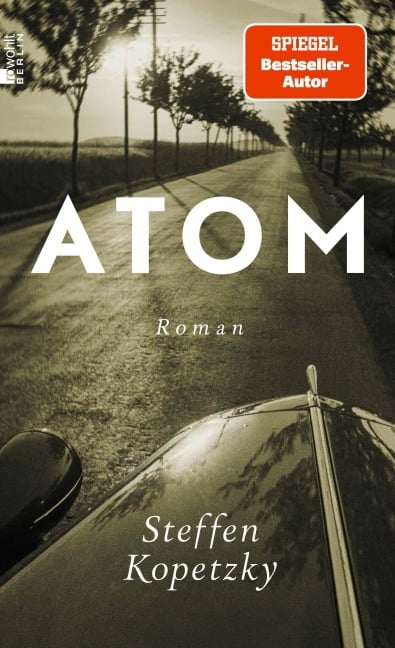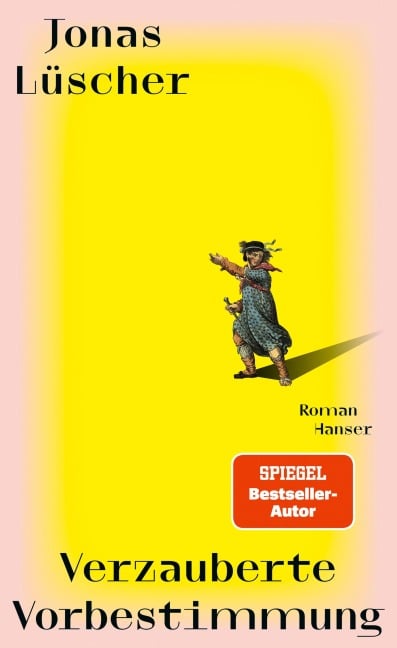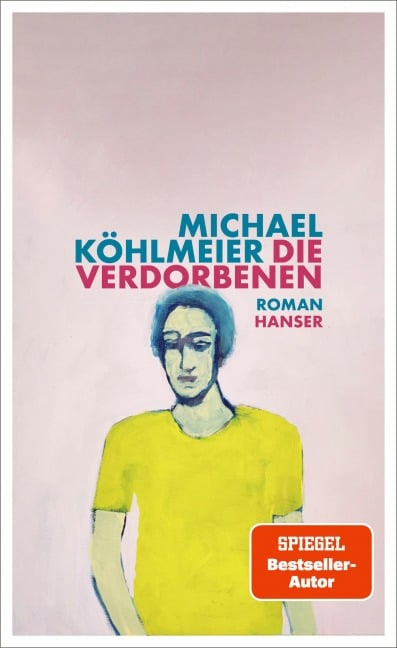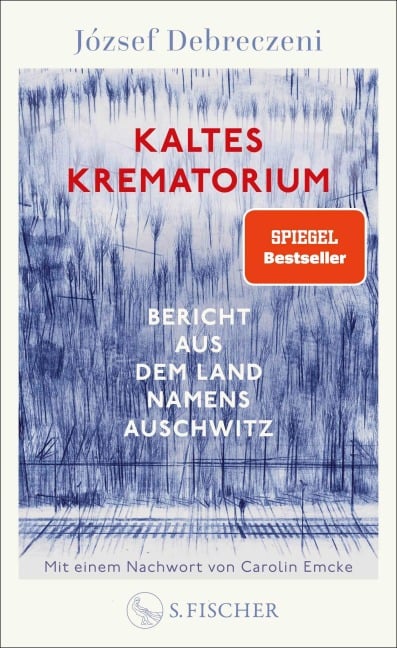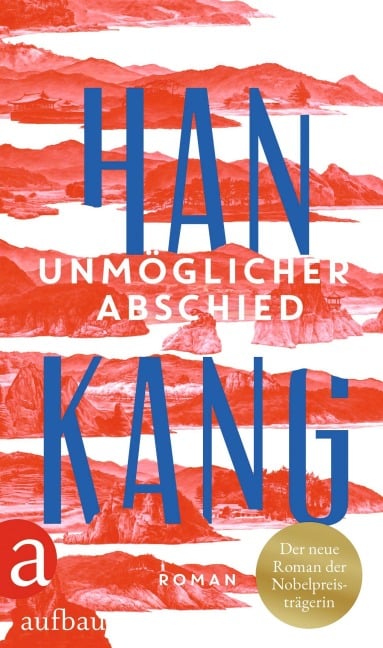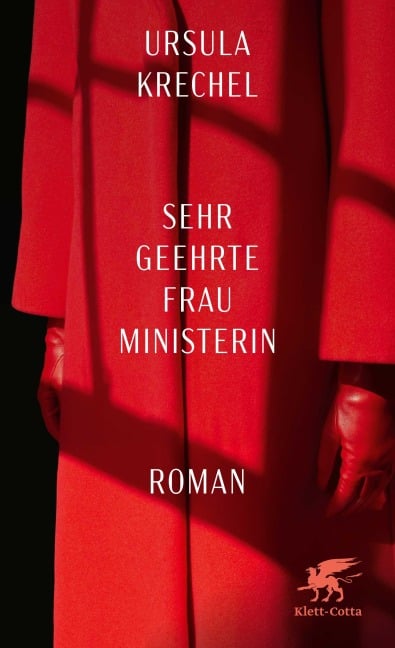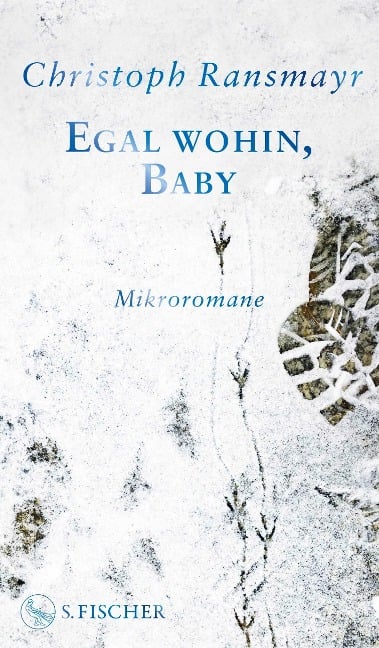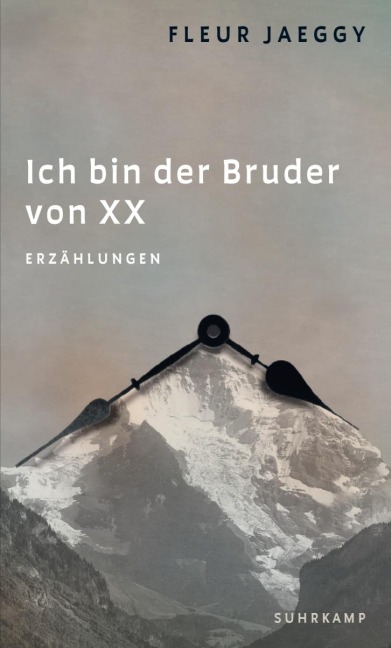Verzauberte Vorbestimmung Jonas Lüscher
gebunden
Der letzte Roman von Jonas Lüscher ("Kraft") ist vor acht Jahre erschienen. Nachdem Lüscher 2020 eine Corona-Infektion nur knapp und durch den intensiven Einsatz moderner Medizin-Technik überlebt hat, meldet er sich mit einem grandiosen Werk zurück. Eingestimmt werden wir durch das Motto "Die Technik wird uns retten und die Liebe auch". Allerdings wird diese Beschwörung der rettenden Kraft der Technik sogleich relativiert, wenn wir im ersten Kapitel einem algerischen Soldaten auf die Schlachtfelder des ersten Weltkriegs folgen, der sich nur knapp vor einem deutschen Giftgasangriff retten kann:
"Sein Geist sagte: kämpfen, rennen, laufen, flüchten. Sein Leib war ein einziges Zittern. Dann ein einzelner klarer Gedanke: Nicht mit ihm. Nicht Teil dieser Maschinerie sein. Nicht mehr rennen, nicht mehr feuern, nicht mehr töten, nicht mehr kämpfen. Einer musste damit aufhören."
Dieses Aufhörenwollen, dieses Sichentziehen wird ein Leitmotiv des Buches sein. Wir folgen dem Schriftstellern und Maler Peter Weiss, dessen frühes Gemälde "Die Maschinen greifen die Menschen an" im Mittelpunkt des Kapitels "Die Menschen greifen die Maschinen an" steht, in dem u.a. die Geschichte der Weberaufstände gegen den Einsatz moderner Maschinerie im 19. Und frühen 20. Jahrhunderts erzählt wird.
Wir folgen dem Ich-Erzähler, der von seinem Überleben einer Corona-Infektion berichtet, als er über Wochen in einem künstlichen Koma lag und wesentliche Körperfunktionen durch Maschinen ersetzt wurden, die ihn retteten. Und wir begleiten ihn in ein phantasmagorisches Ägypten, in dem altägyptische Mythen lebendig werden und der grippekranke, fiebernde Erzähler durch leere moderne Wüstenstädte irrt mit dem mythischem Vogel Ba (mit dem Gesicht des Schriftstellers Peter Weiss) als seiner externalisierten Seele auf der Schulter. Der Erzähler und wir finden uns schließlich in einer dystopischen Zukunft wieder, in der Warnemünde in der Ostsee untergegangen und die als nachputinsches Zeitalter bezeichnet wird. Hier stoßen wir im Ägypten der Zukunft auf die "Angeschlossenen", Menschen, deren Gehirne mit dem Internet verbunden sind und die nicht sterben können, weil ihre Erinnerungen und Persönlichkeiten auf externen Festplatten gespeichert sind, denen im Bedarfsfall neue Körper zugewiesen werden.
Am Ende des Buches wird sich das Motiv des Aufhörens wiederfinden, gewendet gegen den Horror der maschinengestützten Unsterblichkeit. Und es wird die Liebe sein, nicht die Technik, die rettet....
Ein Roman zwar, aber ohne lineare Handlung. Eine Meditation über die rettende und zerstörerische Kraft der modernen Technik, ein souveränes Spiel mit unterschiedlichen Zeitebenen, eine rhythmische Prosa, die fesselt und uns dem Erzähler durch die verschiedensten Episoden bereitwillig folgen lässt. Die Kritik ist zu Recht begeistert:
"Vermutlich wäre es voreilig, nachdem erst das erste Viertel des Jahrhunderts vergangen ist, bereits von einem neuen Jahrhundertroman zu sprechen. Ganz sicher aber hat Jonas Lüscher mit „Verzauberte Vorbestimmung“ einen Roman geschrieben, der nicht nur eindrücklich, präzise und literarisch herausragend von einer wesentlichen Zäsur der jüngsten Vergangenheit erzählt. Jonas Lüscher versteht es auch, diese Erzählung virtuos mit dem historischen und philosophischen Fundament, auf dem wir stehen, zu verweben." (Wiebke Porombka, Deutschlandfunk Kultur)
Von einer Gegenwart, die gern mehr über ihre Zukunft wüsste. Der neue Roman von Jonas Lüscher
Ein algerischer Soldat gerät in den ersten deutschen Giftgasangriff, beschließt, einer müsse damit aufhören, steht auf und geht. Im Kairo der Zukunft beobachtet eine Stand-up-Comedian eine Androidin beim Lachen über ihre Witze. Ein böhmischer Weber wird durch einen automatisierten Webstuhl ersetzt, raubt einen Hammer und attackiert den Apparat. Wovon träumen wir Menschen des Kapitalismus, wovon unsere sich zunehmend gegen uns erhebenden Maschinen? Im einzigartigen Spiegelraum dieses Romans ist kein Konflikt vorbei und noch jede Geschichte möglich. Klug und irrsinnig, komisch und scharf erzählt Jonas Lüscher auf der Höhe seiner Kunst.
zum Produkt
€ 26,00*
 Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".
Und dann auf "Zum Home-Bildschirm [+]".